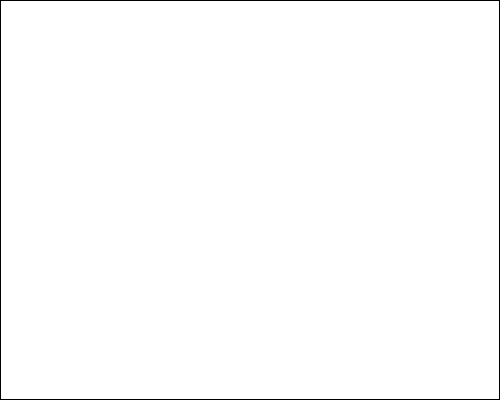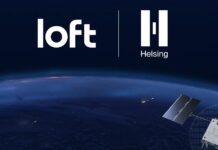Die Ereignisse der letzten Wochen haben Europa erschüttert und die bis dato gültige Sicherheitsarchitektur auf dem Kontinent aus den Angeln gehoben. Angesichts dieser Entwicklung wäre es enorm wichtig eine ernsthafte Diskussion über den Auf- bzw. Ausbaus eines europäischen nuklearen Abschreckungspotenzials, inklusive einer ausführliche Kosten-Nutzen-Analyse, zu führen.
Europas Sicherheitslandschaft
Zuallererst und vor allem steht Europa vor einem grundlegenden Wandel in seiner Sicherheitslandschaft. Aus akademischer Sicht muss hervorgehoben werden, wie außergewöhnlich dies ist. Forscher spekulieren und theoretisieren oft über dramatische Veränderungen im Sicherheitsumfeld eines Staates und deren Auswirkungen auf die Verteidigungsbereitschaft. Doch in der Praxis – vor allem in den letzten 30 Jahren – waren solche Veränderungen selten.
Insbesondere Europa war dank seines stetigen Wirtschaftswachstums, seiner technologischen Stärke, seiner starken Bündnisse und der Abwesenheit unmittelbarer existenzieller Bedrohungen in seiner Nachbarschaft von größeren Störungen verschont geblieben.
All das hat sich nun geändert – leider zum Schlechteren. Das Wirtschaftswachstum stagniert, Europa hat seinen technologischen Vorsprung in Schlüsselbereichen eingebüßt, das Bündnis mit den Vereinigten Staaten ist zerrüttet, und eine sehr reale existenzielle Bedrohung ist in Form eines revisionistischen, imperialistischen Russlands aufgetaucht, das bald glauben könnte, dass Aggression und Krieg belohnt werden.
Politische Führung
Zweitens ist es nicht schwer, diesen dramatischen Wandel zu erkennen, und es darf behauptet werden, dass praktisch jeder europäische Staat inzwischen verstanden hat, wie sehr sich die Sicherheitslandschaft verändert hat. Die Herausforderung besteht darin, darauf zu reagieren, insbesondere in dem erforderlichen Umfang. Hier beginnt die eigentliche Bewährungsprobe.
Die polnische Führung hat diesen Wandel früher als die meisten anderen erkannt und präventive Maßnahmen ergriffen, sogar über verschiedene Regierungen hinweg. Andere beginnen erst jetzt zu reagieren, vor allem, da klar wird, dass die Vereinigten Staaten die Sicherheitsinteressen Europas nicht nur ignorieren, sondern sogar gegen sie handeln könnten. Dänemark sticht hervor, das eine dringende militärische Aufrüstung eingeleitet hat. Macrons jüngster Vorschlag, den französischen Verteidigungshaushalt auf 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen, könnte ebenfalls ein Signal sein, auch wenn wie immer bei Macron abzuwarten gilt, ob es sich dabei um Rhetorik handelt oder ob konkrete Maßnahmen folgen.
Andere Länder haben jedoch noch nicht angemessen reagiert – Deutschland ist erneut das wichtigste Negativbeispiel. Wenn man den Reden von Entscheidungsträgern in Berlin vor der Wahl, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Regierung, zuhört, gewinnt man nicht den Eindruck, dass sie die von einigen ihrer europäischen Verbündeten empfundene Dringlichkeit geteilt haben. Am Wahlabend hat Friedrich Merz, der voraussichtlich der neue Kanzler einer neuen Koalition wird, einen drastischen Kurswechsel im Verteidigungsbereich angekündigt. Allerdings bleibt auch hier abzuwarten, ob den Worten Taten folgen.
Mangelnde Reaktionen auf das veränderte Sicherheitsumfeld sind in jedem Fall nicht auf einen grundsätzlichen Unwillen oder die Unfähigkeit der Streitkräfte oder der Rüstungsindustrie zurückzuführen, eine dringende Aufrüstung vorzunehmen. Das eigentliche Problem ist der fehlende politische Wille, der nach wie vor das größte Hindernis darstellt, wenn es darum geht, die europäischen Staaten dorthin zu bringen, wo sie angesichts der Lage militärisch stehen müssen.
Jeder kennt das Sprichwort: Man zieht nicht mit den Streitkräften in den Krieg, die man will, sondern mit den Streitkräften, die man hat. Die letzten Tage haben deutlich gemacht, dass dies auch für die politische Führung gilt. Man zieht mit den Politikern in den Krieg, die man hat, nicht mit denen, die man will. Wahlen haben auch an dieser Stelle große Konsequenzen.
Nukleare Proliferation
Drittens wurden in den letzten Tagen erneut – und bisher am direktesten – Forderungen nach nuklearer Proliferation in Europa laut. Analysten und wahrscheinlich auch Entscheidungsträger in mehreren europäischen Staaten haben erkannt, dass sich ihr Sicherheitsumfeld erheblich verbessern könnte, wenn sie Zugang zu einer Form der nuklearen Abschreckung hätten.
Der Meinung kann der Autor weitgehend zustimmen. Zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges ist es nun an der Zeit, eine ernsthafte Diskussion darüber zu führen, ob die Atomwaffenarsenale in Europa erweitert werden sollten, und zwar sowohl innerhalb der bestehenden Atomwaffenstaaten als auch bei anderen, die noch keine Atomwaffen besitzen.
Bis vor kurzem stand der Autor der Verbreitung von Kernwaffen aufgrund der immensen Kosten und Risiken, die damit verbunden sind, noch skeptisch gegenüber. Politisch kann sie zu diplomatischer Isolation und wirtschaftlicher Not aufgrund von Sanktionen führen. Man sollte nicht den Fehler machen zu glauben, dass die internationale Gemeinschaft die Verbreitung von Kernwaffen in Europa begrüßen würde. Von den Vereinigten Staaten könnte Europa wahrscheinlich bestenfalls Duldung, aber keine Unterstützung erwarten. Im schlimmsten Fall würden sich die Vereinigten Staaten an der Verhängung von Sanktionen und anderen politischen Maßnahmen beteiligen, um Europa abzustrafen und gegebenenfalls nukleare Proliferationsfälle zu unterbinden.
Es besteht zudem das Risiko eines russischen Präventivschlags gegen die europäische Nuklearinfrastruktur, um die Weiterverbreitung zu verhindern. Obwohl dies rechtlich umstritten ist, könnte Russland versuchen, eine solche Aktion mit dem Völkerrecht zu rechtfertigen. Die Nichtverbreitung von Kernwaffen kann als Völkergewohnheitsrecht betrachtet werden, d. h. selbst wenn die europäischen Staaten aus dem Atomwaffensperrvertrag austreten würden, könnte man argumentieren, dass die nukleare Weiterverbreitung illegal bleibt. Außerdem gibt es Präzedenzfälle für Präventivschläge gegen Atomprogramme: Die internationale Gemeinschaft akzeptierte weitgehend die israelischen Präventivschläge gegen irakische (1981) und syrische (2013) Atomanlagen. Dies deutet darauf hin, dass Russland eine Rechtfertigung für einen solchen Angriff finden und sogar diplomatische Unterstützung innerhalb der UNO erhalten könnte.
Keines dieser Hindernisse bedeutet, dass die Weiterverbreitung von Kernwaffen von vornherein ausgeschlossen werden sollte. In dem Maße, wie Europas neues Sicherheitsumfeld Gestalt annimmt, wird der Nutzen unabhängigerer nuklearer Abschreckung – und stärkerer französischer und britischer Atomwaffenarsenale – immer deutlicher. An diesem Punkt ist eine ernsthafte Kosten-Nutzen-Analyse erforderlich, die sowohl die Vorteile als auch die potenziellen Nachteile der nuklearen Proliferation in Europa berücksichtigt.
Selbst wenn eine solche Analyse nicht zum Start neuer Nuklearprogramme führt, könnte die Schaffung einer glaubwürdigen Bedrohung durch die Verbreitung von Kernwaffen dennoch als strategisches Druckmittel dienen und die Entscheidungsfindung sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Russland erschweren. Dies könnte für Europa von Vorteil sein.
Autor: Fabian Hoffmann ist Doktorand am Oslo Nuclear Project an der Universität Oslo. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Verteidigungspolitik, Flugkörpertechnologie und Nuklearstrategie. Der Beitrag erschien erstmalig am 23.02.2025 in englischer Sprache im „Missile Matters“ Newsletter auf Substack.