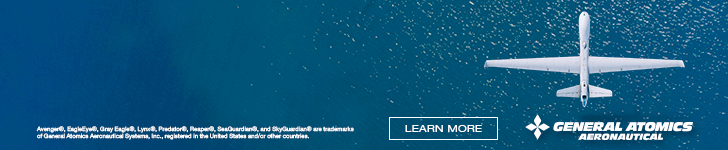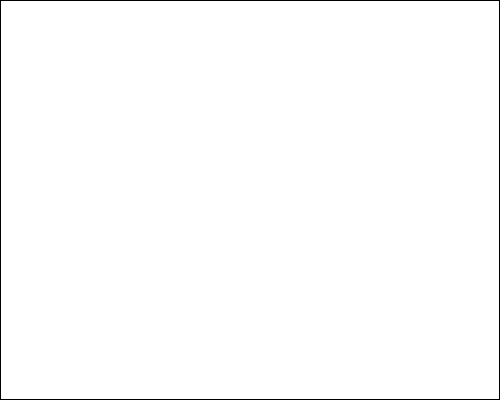Diese Woche hat Trump öffentlich einen Friedensplan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vorgeschlagen. Es überrascht nicht, dass sich der Plan eng an die maximalistischen Ambitionen anlehnt, die Putin und andere russische Offizielle im Laufe der Jahre geäußert haben, einschließlich der Forderung, dass die Ukraine große Teile ihres Territoriums an Russland abtreten soll.
Nur die Ukraine kann entscheide – unter Berücksichtigung der Realität auf dem Schlachtfeld und anderen wichtigen Faktoren –, unter welchen Bedingungen der Konflikt beigelegt werden soll. Die Rolle Europas sollte darin bestehen, der Ukraine die Möglichkeit zu geben, entweder weiter für eine bessere Lösung zu kämpfen oder im Idealfall auf einen Sieg zu drängen. Doch im April 2025 ist Europa immer noch nicht vollständig aus seinem geopolitischen Winterschlaf erwacht und bleibt sowohl materiell als auch kognitiv unvorbereitet, um entschlossen zu handeln. Außerdem fehlt es Europa an einer kohärenten strategischen Vision, was es weiterhin zurückwirft.
Europas Kampf um Relevanz
Die Ukraine sieht sich einem zunehmenden Druck sowohl seitens Russlands als auch der Vereinigten Staaten ausgesetzt. Russland, das sich bewusst ist, dass seine Zukunftsaussichten innerhalb und außerhalb der Ukraine alles andere als sicher sind, wirft gnadenlos alles in den Kampf: Es intensiviert die Raketen- und Flugkörperangriffe auf ukrainische Bevölkerungszentren, erhöht den diplomatischen Druck auf der internationalen Bühne und setzt die Angriffe an der Front trotz steigender Opferzahlen fort.
Gleichzeitig versuchen die Vereinigten Staaten, die Ukraine zur Annahme eines äußerst ungünstigen Friedensabkommens zu zwingen, und betrachten den Krieg weniger als existenziellen Kampf für die „geordnete Weltordnung“, sondern vielmehr als unbequeme Ablenkung am Rande (obwohl die Untergrabung dieser Weltordnung wohl ein zentrales Ziel der Trump-Administration ist).
Europa kann diesen Druck nicht auf magische Weise neutralisieren. Aber es muss zumindest in der Lage sein, der Ukraine Erleichterung zu verschaffen, damit sie nicht unter diesem Druck einknickt und ausreichend Handlungsfähigkeit bewahrt.
In dieser Hinsicht können zwei Hauptaufgaben identifiziert werden, die Europa erfüllen sollte: erstens finanzielle und industrielle Unterstützung, um die ukrainischen Streitkräfte in die Lage zu versetzen, im Kampf zu bleiben und im Idealfall die russischen Streitkräfte zurückzudrängen, unabhängig von anderen Hilfsquellen (vor allem von den Vereinigten Staaten); zweitens die Fähigkeit, eine „ Friedenstruppe “ (ein Begriff, den der Autor nicht mag, der hier hier aber aus Gründen der Kohärenz mit dem öffentlichen Diskurs verwendet wird) bereitzustellen, die jede Verhandlungslösung glaubwürdig durchsetzen kann, wiederum ohne sich auf externe Mächte zu verlassen.
Leider kann Europa derzeit keine der beiden Rollen in ausreichendem Maße erfüllen. Mehr als drei Jahre nach Beginn des Krieges produzieren seine Industrien noch immer nicht in dem erforderlichen Umfang – weder für sich selbst noch für die Ukraine – und es bleibt höchst fraglich, ob die europäischen Staaten über die nötigen Kräfte verfügen, um große Teile in die Ukraine zu entsenden, insbesondere wenn sie gleichzeitig ihre anderen regionalen Verpflichtungen aufrechterhalten. Es stellt sich auch ernsthaft die Frage, ob die europäischen Gesellschaften und politischen Entscheidungsträger auf die Folgen eines solchen Einsatzes vorbereitet sind, einschließlich der Opfer unter den europäischen Soldaten und möglicher russischer Eskalationsmaßnahmen, die darauf abzielen, Europa in die Knie zu zwingen, was nicht ausgeschlossen werden kann.
Das bedeutet weder, dass Europa völlig nutzlos ist, noch dass der Ausgang des Krieges vorherbestimmt ist – Defätismus ist generell ungerechtfertigt und nicht hilfreich. Europa verfügt noch über eine nicht zu vernachlässigende Industrieproduktion und beträchtliche finanzielle Ressourcen. Die Weiterleitung dieser Ressourcen an die ukrainische Rüstungsindustrie hat in den letzten Monaten vielversprechende Ergebnisse erzielt. Dennoch erfüllt Europa in keiner Weise die Rolle, die es eigentlich spielen sollte. Wieder einmal befindet es sich in einer nahezu irrelevanten Position und verlässt sich darauf, dass die ukrainische Entschlossenheit nicht wegen, sondern trotz der fehlenden europäischen Unterstützung Bestand hat.
Es darf nicht bestritten werden, dass sich einige europäische Staaten stark engagiert haben. Das gilt sicherlich für Polen, die baltischen Staaten und zunehmend auch für Dänemark. Andere, wie Schweden, Finnland und Norwegen, haben ebenfalls zuweilen entschlossen gehandelt. Auch Deutschland hat seine industriellen Anstrengungen, insbesondere im Vergleich zur Lage zu Beginn des Krieges, erheblich gesteigert und in einigen Bereichen, etwa der Flugkörperabwehr und der 155mm-Munitionsproduktion, die Kapazitäten massiv ausgebaut. Was allerdings nicht passiert ist, ist eine querschnittliche Mobilisierung aller relevanten rüstungsindustriellen Kapazitäten. Hauptursache dafür sind fehlender politischer Wille in Berlin und eine weiterhin ausgeprägte europäische Kleinstaaterei mit starkem nationalstaatlichem Denken. Weder das Vereinigte Königreich noch Italien, Spanien oder Frankreich waren bereit, nennenswert Geld für deutsche Rüstungsgüter auszugeben. Solange es den großen europäischen Staaten nicht gelingt, Europas verteidigungsindustrielle Basis umfassend zu mobilisieren, werden auch überproportionale Beiträge kleinerer Staaten die entstehenden Lücken nicht schließen können.
Geopolitischer Winterschlaf
Die anhaltende Abwesenheit Europas auf der Weltbühne, selbst bei Fragen von unmittelbarer und existenzieller Bedeutung für seine Region, ist kein Zufall. Europa ist nach wie vor in einem geopolitischen Winterschlaf gefangen, aus dem es noch nicht vollständig erwacht ist.
Den meisten europäischen Staaten ist es gelungen, ihre Verteidigungsbudgets seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine zu erhöhen, viele von ihnen sogar erheblich. Was Europa jedoch weitgehend fehlt, ist eine strategische Vision. „Strategie“ beschreibt den Einsatz von Mitteln zum Zweck. Dies setzt voraus, dass der gewünschte Endzustand klar definiert ist, bevor Mittel zugewiesen werden können. Wofür genau kämpft Europa also in der Ukraine?
Im Wesentlichen kämpft Europa für die Erhaltung eines Status quo, der für den Kontinent außerordentlich vorteilhaft war – ein Status quo, der auf regionaler Stabilität, freiem Handel und demokratischer Entwicklung beruhte. All diese Errungenschaften sind durch Russland ernsthaft bedroht worden. Dennoch gibt es in Europa immer noch zu wenige Entscheidungsträger, die sich entschieden und überzeugend für ihre Verteidigung einsetzen.
Die Unfähigkeit einer Status-quo-Macht, eine klare Vision in strategischer Hinsicht zu formulieren, ist keine historische Anomalie. Für revisionistische Mächte ist es oft deutlich einfacher, den von ihnen angestrebten Endzustand zu definieren und schnell Ressourcen zu dessen Unterstützung zu mobilisieren. Schließlich lässt sich ein Wandel leichter zu konzipieren als ein Fortbestehen.
Das Gleiche gilt für militärische Strategien. Die europäische Aus- bzw. Aufrüstung wird weit weniger effektiv sein, wenn sie nicht in ein kohärentes Bündel militärischer Strategien eingebunden ist. Die Definition dieser Strategien beginnt wiederum mit dem Endzustand, den die europäischen Staaten erreichen wollen: Russland abzuschrecken und, falls die Abschreckung fehlschlägt, Russland zu den geringstmöglichen Kosten für Europa zu besiegen. Der nächste Schritt besteht darin, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlichen militärischen Mittel zu definieren. Am besten lässt sich dies nach Ansicht des Autors durch den Aufbau einer glaubwürdigen Vorwärtsverteidigung erreichen, die durch eine Langstreckenflugkörperfähigkeit ergänzt wird, mit der Russland im Bedarfsfall erhebliche Kosten auferlegt werden können. Erst wenn diese strategischen Grundlagen geschaffen sind, sollte man sich den spezifischen Militärtechnologien zuwenden, die zur Umsetzung einer solchen Haltung erforderlich sind.
Ein Satz, der in den letzten Wochen immer wieder zu lesen und zu hören war (z. B. in diesem ausgezeichneten Beitrag), lautet: „Europa braucht Strategen, keine Buchhalter.“ Mit diesem Satz wird eine wichtige Wahrheit auf den Punkt gebracht. Geld allein wird die tiefsitzenden Probleme Europas nicht lösen. Europa braucht Menschen – sowohl in Uniform als auch in zivilen Führungspositionen –, die strategisch denken und eine kohärente Vision umsetzen können, die politische Ziele mit militärischen Mitteln verbindet. Für die europäischen Bevölkerungen, die das Privileg genießen, in Demokratien zu leben, bedeutet dies letztlich, dass sie die grundlegende Verantwortung tragen, vorausschauende Politiker in Ämter zu wählen. Die Parteien wiederum haben die Verantwortung, solche Kandidaten überhaupt zu nominieren. Wenn die Wähler Leute in Ämter wählen, die grundsätzlich auf Abblendlicht fahren, dann darf man von diesen nicht erwarten, dass sie auf Fernlicht umstellen können. Entsprechend ist nicht nur die Politik gefordert, entschlossen zu handeln. Auch die Wähler tragen Verantwortung: Kurzsichtiges Handeln und Unentschlossenheit müssen an der Wahlurne bestraft, weitsichtige Politik und strategische Vision hingegen gezielt unterstützt werden.
Autor: Fabian Hoffmann ist Doktorand am Oslo Nuclear Project an der Universität Oslo. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Verteidigungspolitik, Flugkörpertechnologie und Nuklearstrategie. Der Beitrag erschien erstmalig am 27.04.2025 in englischer Sprache im „Missile Matters“ Newsletter auf Substack.