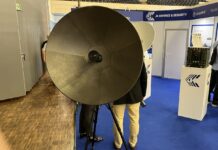Die zukünftige Regierungskoalition von Union und SPD nennt in ihrem in der vergangenen Woche veröffentlichten Koalitionspapier die Raumfahrt als Zukunfts- und Schlüsseltechnologie, die für Deutschlands Sicherheit und militärischen Fähigkeiten zentral sei. Ziel sei es, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands im Weltraum entschlossen und zügig auszubauen. „Eine nationale Weltraumsicherheitsstrategie werden wir im ersten Regierungsjahr veröffentlichen“, schreiben die Koalitionäre.
Konkret ist eine Reihe von Maßnahmen vorgesehen, um den Sektor zu fördern. Dazu gehört der Ausbau der Forschung, die Entsendung eines deutschen Astronauten im Rahmen einer internationalen Mission zum Mond oder die Beteiligung an einer ISS-Nachfolgelösung.
Außerdem will die Bundesregierung den Trägerraketensektor und Initiativen wie eine Startplattform in der Nordsee unterstützen, um souveräne Kapazitäten zur Verbringung von Satelliten ins Weltall von Europa aus zu schaffen. Gerade für militärische Anwendungen ist dieser erforderlich, um flexibel und schnell ausgefallene Satelliten zu ersetzen oder bestehende Systeme umzukonfigurieren. „Unverzichtbar sind auch eigene Fähigkeiten zur Erdbeobachtung und Kommunikation (zum Beispiel Galileo und IRIS2)“, heißt es in dem Papier. Dazu soll eine resiliente Satelliteninfrastruktur geschaffen werden.
Eine sichtbare Aufwertung erhält der Sektor über die herausgehobene Stellung im neuen Zuschnitt des Ministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt, das von der CSU geführt werden soll.
Beim Ausbau der deutschen Weltraumfähigkeiten kann sich die Bundesregierung auf bereits bestehende Strukturen stützen. Denn schon heute tauscht sich die Bundeswehr mit Partnern aus, um Synergien zu erzielen und sich gegenseitig zu unterstützen. „Weltraumsicherheit kann keine Nation allein gewährleisten, daher arbeitet Deutschland mit unseren internationalen Partnern in der Combined Space Operations Initiative zusammen. Mit inzwischen zehn Teilnehmern (AUS, CAN, DEU, FRA, GBR, ITA, JPN, NOR, NZL, USA) koordinieren wir dort eng unsere Weltraumsicherheitspolitik und Normen für verantwortungsvolles Verhalten und schaffen durch die Steigerung unserer Interoperabilität die Grundlagen für gemeinsame Weltraumoperationen“, teilte dazu ein Sprecher des Cyber- und Informationsraums (CIR) der Bundeswehr mit.
Mit sieben dieser zehn Partner setze die Bundeswehr dies im Rahmen der US-geführten Weltraumoperation OLYMPIC DEFENDER in die Tat um. Weitere multinationale Vorhaben sind dem Sprecher zufolge das NATO-Projekt NORTHLINK, zur Abdeckung der Arktis sowie europäische Kooperationen wie Galileo, Copernicus und der Weltraumlagekooperation EU SST (Space Surveillance and Tracking), um die strategische Unabhängigkeit Europas zu stärken.
Darüber hinaus arbeite die Bundesrepublik bilateral mit Partnern zusammen. Insbesondere mit Norwegen sei mit der kürzlich erfolgten Zeichnung einer bilateralen Absichtserklärung zur Vertiefung der deutsch-norwegischen Zusammenarbeit im Weltraum eine „vielversprechende Grundlage“ für die Entwicklung einer verteidigungsfähigen Weltraumarchitektur geschaffen worden. Dies beinhaltet unter anderem die Erweiterung von Startkapazitäten für militärisch genutzter Kleinsatelliten im Sinne des Ansatzes „Responsive Space“.
Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte dazu nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung mit seinem norwegischen Amtskollegen Anfang Dezember vergangenen Jahres erklärt: „Norwegen ist ein strategisch wichtiger Weltraumakteur – mit einer starken, wettbewerbsfähigen Raumfahrtindustrie. Insbesondere aufgrund seiner geographischen Lage und dem neu eröffneten Weltraumbahnhof in Andøya ergeben sich daraus viele Optionen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Bundeswehr wird ihre Expertise aus den Bereichen Weltraumsicherheit und Raumfahrtindustrie mit einbringen. Ich bin mir sicher, dass diese Zusammenarbeit ein wichtiger Baustein einer verteidigungsfähigen Weltraumarchitektur sein wird.“
Nach Aussage des CIR-Sprechers pflegt die Bundeswehr überdies eine enge Partnerschaft mit den USA, insbesondere in den Bereichen Weltraumlage und Satellitennavigation.
Der Teilstreitkraft CIR kommt nach eigenen Angaben bei der Beschaffung und dem Betrieb von Satelliten die Rolle als abstimmendes Element zu. Sie definiert in Abstimmung mit den anderen Teilstreitkräften den Bedarf und die Forderungen an die notwendige Leistungsfähigkeit des Geräts. Mit der Bestätigung des Bedarfs durch das Verteidigungsministerium und das Parlament begleiten Projektbeauftragte die Beschaffung, die in der Verantwortung des Bundeswehr-Beschaffungsamtes BAAINBw liegt. Mit Übergabe des Satelliten in die operative Nutzung endet der Beschaffungsprozess und damit die Verantwortlichkeit des BAAINBw. Dann geht die Verantwortung an das CIR als Nutzer über, die dann streitkräfteübergreifend Leistungen den Teilstreitkräften bereitgestellt.
Die weltraumbezogenen Aktivitäten der Bundeswehr werden unter dem Begriff als „Dauereinsatzaufgabe Weltraumnutzung“ zusammengefasst. Unterschieden wird dabei zwischen Weltraumoperationen und der Einsatzunterstützung aus dem Weltraum. Weltraumoperationen sind nach Definition der Bundeswehr Aktivitäten zum Schutz und zur Verteidigung militärischer Satellitensysteme und fallen in den Verantwortungsbereich des bei der Luftwaffe verorteten Weltraumkommandos der Bundeswehr.
Für die Einsatzunterstützung aus dem Weltraum ist hingegen die neue Teilstreitkraft CIR zuständig. Durch eine enge Zusammenarbeit der Teilstreitkraft CIR mit dem Weltraumkommando der Bundeswehr in Uedem erfolge eine koordinierte und auf militärische Bedarfe ausgerichtete Nutzung des Weltraums, so der Sprecher des CIR.
Lars Hoffmann